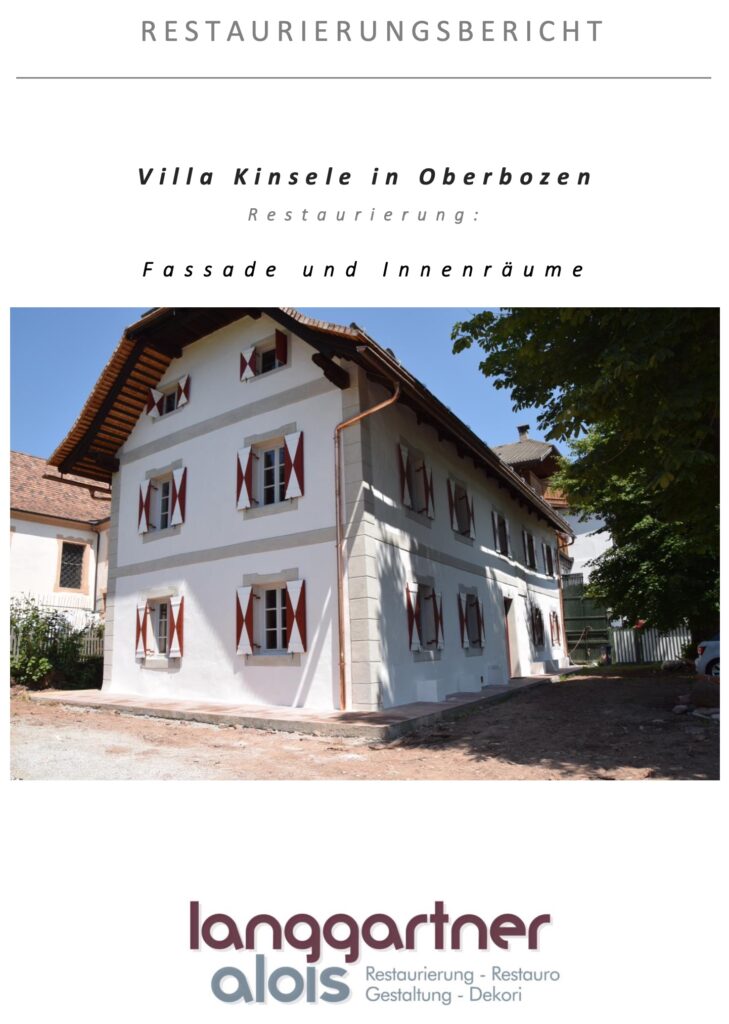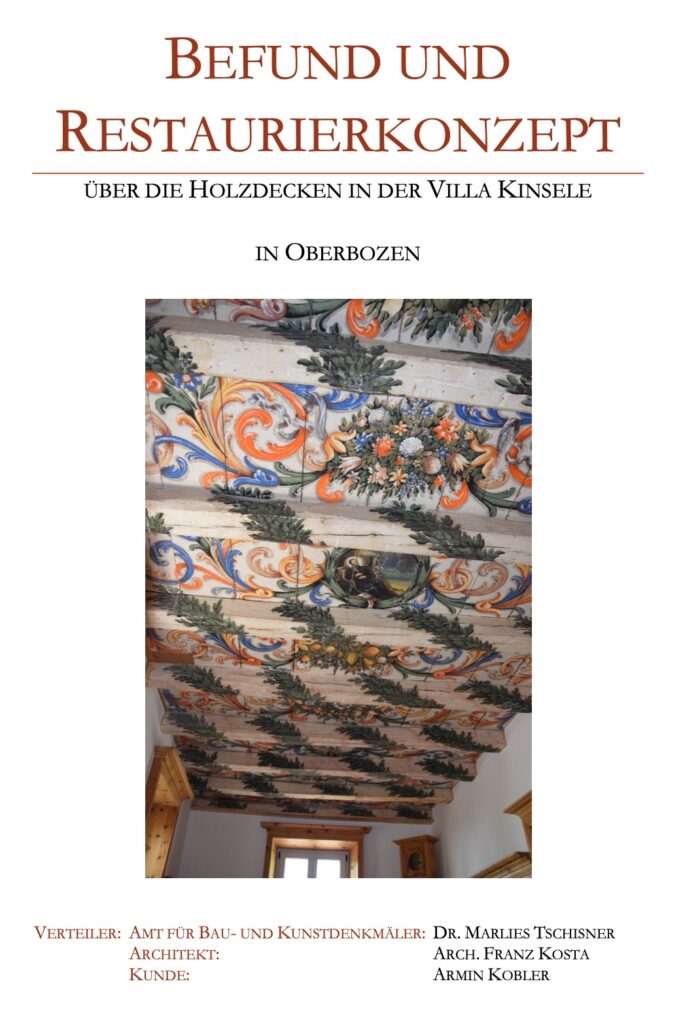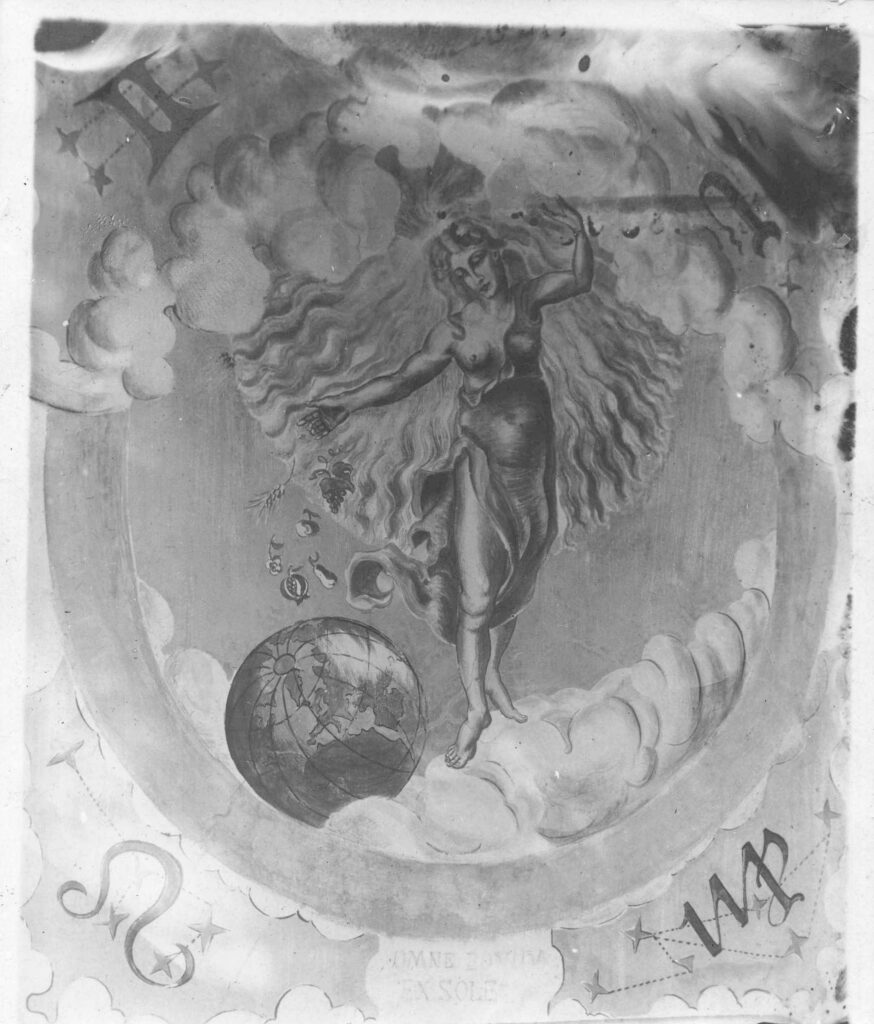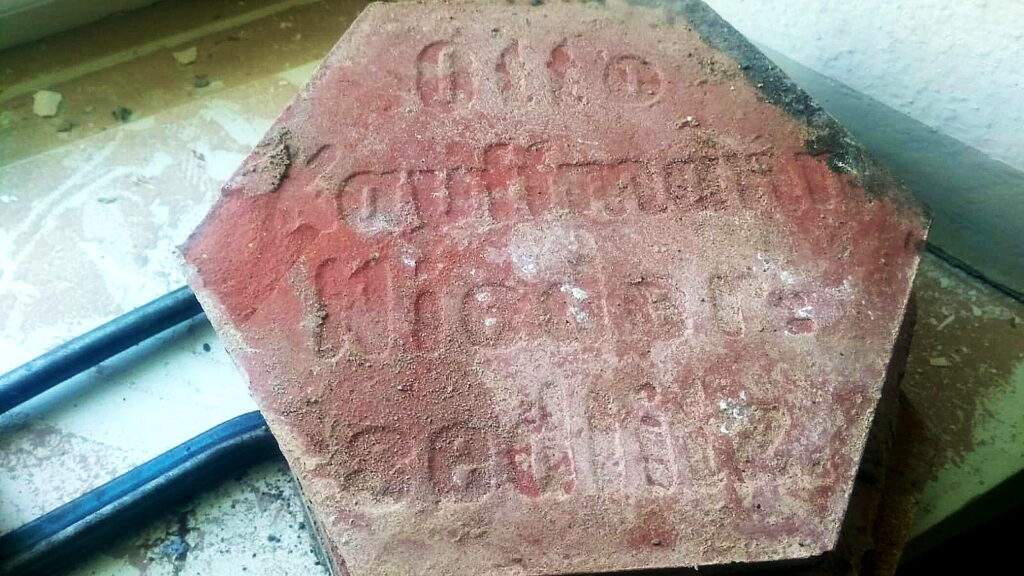Mit dem Setzen der Bäume längs der zusätzlichen Einfahrt, welche im Rahmen von kleineren Grenzverschiebungen mit dem südlichen Nachbarn gebaut wurde (ich berichtete), kann auch dieses Vorhaben als beendet betrachtet werden. Es stimmt, der Bretterzaun muss wieder montiert und ergänzt werden und mittelfristig wäre es sinnvoll, auch ein Gitter am Beginn der Rampe montieren zu lassen. Aber momentan will ich weitere Ausgaben vermeiden und die Benutzbarkeit ist ja so auch gegeben.

Entlang der zur oberen Wiese führenden Rampe haben wir Bäume setzen lassen. Der tradierten Umgebung gemäß zwei Winterlinden (Tilia cordata) und zwei Rosskastanien. Bei letzteren fiel dieses Mal die Wahl auf rosa blühende Exemplare (Aesculus x carnea). Erstens aus ästhetischen Gründen und zweitens, – leider wichtiger – weil diese natürlichen Hybride resistent gegenüber der sich sehr stark ausgebreiteten Miniermotte (Cameraria ohridella) sind. Anfällig ist dieser natürliche Hybrid aber wie seine Gattungsgenossen auf den die Blattbräune der Rosskastanie verursachenden Pilz Guignardia aesculi.
„Erschließung mit Bepflanzung abgeschlossen“ weiterlesen